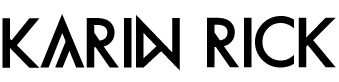Die Vision, dass eine Frau in der Lage ist mit ihrem Talent, ihrer Kunst berühmt zu werden und der meistverdienende Star der Welt zu werden ist für viele Männer besonders ärgerlich.
Der zerstörte Safe-Space
Das Fan Zitat, ‚wir wären an diesem Abend in einem besonderen Setting gewesen, in dem man sich als weiblich gelesene Person wohl und sicher fühlt‘, spiegelte die Bedeutung des verlorenen Konzerts vielleicht am besten wider. Es war das, was mich an der Absage so traurig machte und ein so starkes Gefühl des Verlustes erzeugte. Genau diesen ‚safe space‘ hätte ich gern miterlebt. Dass er selten ist, sollte zu denken geben. Denn nicht nur islamistische Terrorverdächtige verdammen einen queer-feministischen Safe Space. Was Taylor Swift zu so einem aufreizenden Feindbild macht, ist diese frech zur Schau gestellte, provokant sexy auffallende Weiblichkeit, die nicht darauf angewiesen ist,einem Mann, Männern überhaupt zu gefallen. In ihren Songs leuchtet das Augenzwinkern weiblicher Dominanz. Aber mit purer „femininity“ tat sich unsere Kultur immer schon schwer.
Der geplante Anschlag auf ihr Konzert kam daher nicht von ungefähr. ‚Die Persona Swift zeigt Menschen aller Altersgruppen und besonders Mädchen Ideen von weiblicher Existenz auf, die zwar mit Spaßkultur und Kapitalismus verstrickt sind, (…), die aber neue Perspektiven eröffnen‘, so die Soziologin für Gender Studies Katja Kauer. ‚Deshalb ist Swifts popfeministische Resonanz für Anhänger des Islamischen Staates besonders ärgerlich.“
Dazu gehört auch die Vision, dass eine Frau in der Lage ist mit ihrem Talent, ihrer Kunst berühmt zu werden und der meistverdienende Star der Welt zu werden. Natürlich verkörpert sie damit in erster Linie die wohlhabende Selfmade woman der weißen Mittelschicht, die sich alles erlaubt – ohne das Vehikel Mann Musik zu machen, finanziellen Erfolg zu haben, schillernd und im Mini vor großem Publikum zu tanzen und sich zu produzieren, breitbeinig wie eine Kriegerin in Glitzerstiefeln, große Menschenmassen zu erreichen und zu faszinieren, sosehr dass sie untereinander eine Community bilden. Wenn man, wie der Grazer Forscher für Jazz- und Populärmusik Doehring feststellt, dass ‚Pop-Musik Spielfeld für symbolische, aber auch manifeste ideologische Machtkämpfe ist‘, kann man erahnen, was die Ikone Taylor Swift an Ressentiments auslöst.
Die Show – Intellekt und Libido triggernder Höhenflug
Trost für die gestrandeten Swifties in Wien und anderen österreichischen Hauptstädten wurden an dem Wochenende der abgesagten Show en masse gespendet. McDonalds lockte mit einem 1 Euro Menu, die öffentlichen Bäder waren für die Ticket InhaberInnen gratis, in Graz gab es einen Swiftie Park, wo man sich bei Taylors Musik austauschen konnte, der Bundespräsident empfing eine ‚Swiftie Delegation‘. Der ORF brachte das Bravourstück zusammen, von Disney+ die Free-TV Rechte der bereits verfilmten Eras-Tour in Los Angeles, die erst im November in die Kinos kommen soll, für einen einzigen Abend zu ergattern und meine Partnerin und ich machten es uns pünktlich um 21 Uhr vor dem TV-Gerät gemütlich.
Die Show war unglaublich. Ein nicht enden wollendes Feuerwerk an Visuals, Farben, Klängen, Geglitzer und der Performance des Superstars selbst. Ihre Stimme, ihre Songs, ihre Ausstrahlung, ihr selbstsichere Autoerotik, tanzend und singend – ein Spiegel für ihre Fans. Ein narzisstisch-sinnlich-lyrisch aufgeladenes Multiversum um eine unangefochtene Königin herum. Sie zu hören und zu sehen war wie ein Rausch. Ein Intellekt und Libido triggernder Höhenflug drei Stunden lang. Wir versanken darin und lösten uns in einem gemeinsamen Song-Text-Poesie-Fieber auf. Auch am nächsten Tag, als wir Taylors Texte lasen und verglichen, welche Zeilen wohl die schönsten, treffendsten seien, zitierten wir um die Wette. Sprache und Bilder universell und doch einzigartig, Lyrics ohne Klischee und Kitsch. Brillant und originell. Die Fans können alles auswendig, sie skandieren die Songs, Schlachtrufen gleich, in den Straßen, in Clubs und auf Konzerten. Es ist ein Siegeszug der Sprache in unserer audiovisuell zugemüllten Welt.
Um wieder zu l’hymne de l’amour von Edith Piaf zurückzukommen, gesungen jüngst bei der Eröffnung von Olympia von Celine Dion: die bedingungslose, selbstzerstörerische, abgöttische, heteronormativ leidende Liebe, die Edith Piaf damals als weibliches Schicksal zelebrierte und die privat den Ruin der Chanteuse herbeiführte, gibt es bei Swift nicht. ‚Got a long list of ex lovers, they’ll tell you I’m insane. But I’ve got a blank space, baby. And I’ll write your name.’ Aus jedem Liebesdebakel steigt sie wie Phönix aus der Asche und macht einfach einen Song daraus. „I cry a lot but I am so productive, it’s an art.” Wie wahr. Slay Queen, das ist sie für mich.
Erschienen in: Mein heimliches Auge 39, Hg: Claudia Gehrke, Uve Schmidt, Verlag Claudia Gehrke, Tübingen, 2024