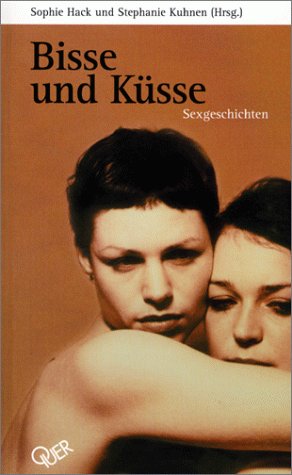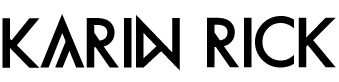Der Hafen liegt friedlich und unschuldig in der Morgensonne, als ich sie abhole. Noch bevor sie mich bemerkt, sehe ich sie an der Mole sitzen, mit dem Rücken zu mir, in einer scheußlichen, türkisgrünen Jacke, den Kopf etwas in die fleischige Schulterpartie eingezogen, gedrungen, mit ihrem wabbeligen Kinn, mit ihren rostrot gefärbten, leicht gelockten Haaren, unansehnlicher, kurzer Schnitt, ihrem breiten Gesicht, die Augen verschwinden im Wangenfleisch, dieses lupenartig vergrößert durch die Brillengläser. Nein, denke ich wieder, bitte nein, sie ist abstoßend, ja lächerlich, erregt meinen Ärger über ihren so offensichtlichen Verzicht auf Eleganz, auf gutes Aussehen. Dann habe ich Schuldgefühle, weil ich sie ablehne, und bemühe mich, diese Abstoßung zu überwinden und freundlich, zuvorkommend, nett zu sein. So viele andere Leute hätte ich in aller Freundschaft treffen können, aber nein, ich bin vier Tage hintereinander mit dieser Carmencita ausgegangen und fahre jetzt mit ihr ins Wochenende. Nicht sie, sondern ich war es, die vorgeschlagen hatte, gemeinsam ins Kino zu gehen, Good Will Hunting. Auf Spanisch, so dass ich kein Wort verstand. Meine Idee war es, sie zum Abendessen einzuladen. Was sie über sich erzählte war drollig, bildhafte Anekdoten über ihr Leben, keine einzige Story langweilig. Sie war ein starker Charakter, leidenschaftlich und politisch engagiert. War imstande, an Baukräne angekettet gegen neue Hotels zu protestieren. Den Karneval liebte sie über alles. „Heuer werde ich als Qualle gehen“, sagte sie und lachte los, und diese Vorstellung war nun doch zu bunt, zu komisch, sie, die dicke Carmencita als Qualle, mit einer Halskrause und Tentakel. Selbstironie hoch zehn. Ich begann sie zu mögen. Sie lächelt mich ohne Harm an, als ich nun auf sie zugehe. Sie riecht nach Milch, die Luft ist auf einmal von Milchgeruch erfüllt, was ich nicht leiden kann. Ich habe Angst vor diesen zwei Tagen mit ihr, ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, mich abzugrenzen. Der Morgen ist klar und ohne Wolken, das Meer ruhig bei der Überfahrt. Kaum sind wir auf dem Schiff, setzt sie sich neugierlos, wie alle Einheimischen auf eine der Bänke und wartet auf die Abfahrt. Ich Touristin jedoch wandere herum, lehne mich an die Reling, bin froh über ein bisschen Aufschub von ihrer Anwesenheit. Sie sitzt neben einer orangefarbenen Rettungsboje, die fast so groß und breit ist wie sie, und winkt mir zu, hinter ihr zwei sonngebrannte Surfer mit blondgefärbten Dreadlocks, schlank und durchtrainiert. Das von ihr reservierte Zimmer in der Pension ist eng und spartanisch, aber wenigstens sind die Betten getrennt, an die Wand geschoben. Carmencita ist nun in Urlaubsstimmung und noch besser aufgelegt als sonst. Sie zeigt mir eine Bermuda, die sie extra für unseren Ausflug gekauft hat, in hellem Grün. Die geht ihr bis zu den Waden runter. Sie ist stolz auf diese Hose, stellt sich breitbeinig mit den Händen in den Taschen auf die niedrige Hafenmauer. „Alle machen sich über die Hose lustig“, sagt sie, „ich schau ja wirklich wie Bajazzo aus.“ Ihr Mut zur Hässlichkeit kennt keine Grenzen. Sie ist putzig in der Hose, finde ich ja auch. Die macht eine bessere Figur, als alle anderen Klamotten, die sie bis jetzt trug, unterstreicht ihren Typ. Sie war ja einmal Spitzensportlerin in der Handballnationalmannschaft, die festen Schenkel zeugen jetzt noch davon. So wir ziehen los zur Inseleroberung. Auch hier kennt sie alle, die sie trifft, tratscht mit dem Bäcker, dann verschwindet sie im Lebensmittelladen auf einen Plausch mit der Bürgermeisterin, die an der Kassa sitzt. Der Laden gehört ihr. Ich warte geduldig. Soll sie ruhig zehn Minuten in einem mir unverständlichen, spanischen Dialekt mit jemanden reden, es macht mir nichts aus. Sie ist so bar jeder Koketterie, dass sie alles darf. Jetzt kommt sie mit einer riesigen Tüte Lebensmitteln, als wären wir kurz vor dem Verhungern. Im Hintergrund mystisch die Klippen der Nachbarinsel im Gegenlicht. Dort, wo diese gegen Südwesten abfallen, zu einer sanft geschwungenen Ebene auslaufen, liegt um diese Jahreszeit den ganzen Tag über die silberne Schicht der Sonnenstrahlen auf dem Wasser, die in Millionen Lichtblitzen hin und her springen. So tanzt und schillert es auf unserem Weg. Wir gehen am Meer entlang zu den einsamen Stränden, bleiben oft stehen und heben Muscheln auf, sie zeigt mir im Sand vergrabene Wassertiere, wirft einen Stein ins Wasser, der diese aufstört. Aus unzähligen Trichtern sprudelt es hervor. Tu has provocado una revolucion, sage ich gewichtig, und wir lachen los. Wir schwimmen nackt und liegen dann reglos in der Sonne. Mit all dem Ausziehen und ins Wasser Laufen, mit dem Herzeigen nackter Haut, den Körper auf dem Badetuch langsam und genussvoll durchstrecken, im Wasser liegen und mich von ihr photographieren lassen, wecke ich nur ihr Begehren, denke ich, ich sollte mich zurücknehmen. Gleichzeitig macht mich diese Nacktheit leicht, so als ob die Wahrheit zwischen uns endlich ans Licht käme. Die ersten Nachtstunden verbringen wir in einem Lokal, in dem die Dorfjugend Flipper spielt. Sie leert einen Ron con Cola nach dem anderen. Bei langsamen Songs wird sie rührselig, singt mit und versucht, sie mir zu übersetzen, schaut mich immer wieder Zustimmung heischend an, so dass ich sie plötzlich an den gepolsterten Schultern packe und an mich ziehe. Sie lässt es willig mit sich geschehen, ihr Kopf liegt auf meiner Schulter und ich streichle voller Sympathie ihre wolligen Haare. Die Brüste kleben an meinen, nachgiebige Bälle, die mich erregen. Als wir die Bar verlassen liegt der Hafen still im Sternenlicht. Sie küsst mich und ihr Griff ist voller Energie.
2 Ein kühler Wind weht heute und so liege ich fast ganz angekleidet am Strand. Trage T-Shirt und Badehose, den Sonnenhut habe ins Gesicht gezogen, auf meinen Beinen ein Handtuch gegen die Fliegen. Ich habe den Kopf von ihr abgewandt, die Stimmung zwischen uns ist desillusioniert. Gestern nacht habe ich sie zurückgewiesen. Sie versichert zwar, dass sie nicht wütend auf mich sei, aber durch meine Weigerung ist sie in ihrer Spontaneität gedämpft. Ich bin übermüdet, schlaff und antriebslos. Auch meine konstanten Bemühungen, sie mir vom Leib zu halten, strengen mich an. Ich rede nichts. Sie steht auf einmal auf, um schwimmen zu gehen. Ich will ihren Körper nicht mehr sehen, aber als sie aus dem Wasser kommt, baut sie sich vor mir auf, trocknet sich ab und lässt die Brüste tanzen. Ich kann nicht anders, als sie anzuschauen, auch deshalb weil sie dauernd auf mich einredet. Sie macht alles, um meine Aufmerksamkeit wieder auf sie zu lenken. Sie wirft sich nackt in den Sand, etwas weiter weg von mir, leider nicht lange, während sie dahinplaudert robbt sie näher, schaufelt zum Spaß ihre Brüste mit Sand zu, hebt sie und zeigt mit den Abdruck, den diese im Boden hinterlassen haben. Wie ein verspieltes Kind lacht und albert sie herum. Ich starre sie gebannt an, wie die Maus die Schlange. Ich würde am liebsten weit weg sein, schlafen und diese Niederlage vergessen: meine Ablehnung, nicht einmal sosehr ihres drallen Körpers, sondern eher ihrer Art, mich zu berühren, wie sie es gestern nacht kurz vor dem Schlafengehen tat, diese ärgerliche Ablehnung ihrer plumpen, schnellen, ungeschickten, ungeschliffenen Zärtlichkeiten, die nur auf das eine zustrebten, die sich, aus Angst womöglich nichts von mir zu bekommen, gleich alles nehmen wollten, und hastig über mich hinweghudelten, schnell da ein Griff zu einer Brustwarze, schnell dort die Hand zwischen die Beine schieben, das T-Shirt hinaufzerren, mich zum Bett drängen und mich mit ihrem, gut einen Zentner schweren Leib niederhalten, als könnte mir das gefallen. Aus Zorn vor soviel Unsensibilität habe ich nein gesagt. Das Übergewichtige, Klobige hätte ich sogar ertragen. Auch das Flanellpyjama mit den Blümchen, von der Großmutter. Vergessen, verdrängen will ich die gestrige Nacht, auch den schnellen Kuss am Hafen, aber sie lässt mich nicht. Da liegt sie nun dicht an mich herangerollt, nackt, glitschig, ein Flusspferd, und sagt: „Du hast aber kleine Hände, como una muneca, Puppenhände sind das.“ Sie legt ihre Handflächen an meine, dann streichelt sie meine Finger und ich lasse es geschehen. Ihr Ballen ist schwielig und hart. Ermutigt schlingt sie den Arm um meine Taille, und ich stoße sie nicht weg, denn Berührung ist Berührung, und ich bin ausgehungert nach zwei Wochen ohne Sex, die Sonne allein macht mich wollüstig und bereit, jetzt auch noch die Berührung eines anderen Menschenkörpers. So reagiere ich nicht sofort, das ist für sie wie eine Aufforderung, nun legt sie das Gesicht auf meine Brust. Nein, denke ich, nicht schon wieder, nicht wie gestern in dem kargen Hotelzimmer, sie soll aufhören. Ende, aus. Aber ich bewege mich immer noch nicht, halte still, stupse sie nicht ärgerlich weg, und nun küsst sie durch das T-Shirt hindurch meine Brüste. Die Hitze ihrer Lippen – ich sträube mich, „Lippen“ zu sagen, bei allem was nun folgen wird, will ich an keinen ihrer Körperteile denken, an nichts Spezifisches, an nichts Konkretes, an nichts, was sich sonderlich hervorheben würde – nun aber spüre ich deren Weichheit auf meinen Brüsten, und stöhne tief auf. Mit diesen Lauten verursache ich einen Ausbruch von Leidenschaft in ihr, wider Willen bis jetzt aufgestaut. Sie drängt sich blitzschnell an mich, unglaublich für einen so massigen Körper, die Hand zuckt unter mein T-Shirt, schiebt es hinauf. Und wieder denke ich, so nicht, man kann die Warzen doch nicht einfach aufsaugen, das ist nicht erregend. Da gibt es ganz andere Feinheiten, die kannst du einfach nicht, Carmencita, so laß doch meinen Körper in Ruh. Aber ich schaffe es nicht mehr, mich zurückzuziehen, es ist zu angenehm, den Kontakt mit diesem schwammig weichen, um mich herumflutenden Körperfleisch zu spüren, ihre Erregung zu erleben. Dass sie mich gar so sehr will. Ich stöhne weiter und strecke mich durch, mit dem Becken ihr entgegen, ich muss dringend pissen, die Blase ist zum Platzen voll, ich will aber nicht unterbrechen, denn ich fürchte, dass danach meine Abwehr siegt. „Augen zu und durch“, denke ich, da hat sie ihre Hand schon um meine Hüften geschlungen, packt meine Popacken, ungeachtet des Höschens kommt sie nun „von hinten“ an mich ran. Ich werde heiß und nass, ihre Hand krallt sich in meinen Po, ihre Finger suchen im Spalt weiter, ich ächze vor Genuss, obwohl der Stoff des Slips in meiner Fut klemmt. Nach außen hin bewege ich mich fast nicht, ich spiele „auf Halbmast“. Auf einmal hievt sie sich wie gestern in einem einzigen Schwung auf mich, ich habe gerade noch Zeit, das Höschen auszuziehen, schnell, schnell, denn ihr fiele es nicht im Traum ein, mir etwas zu erleichtern, da liegt sie mit ihrem hundert Kilo Gewicht auf mir und reibt ihre Fut an meinem Schenkel, wetzt, schiebt, dringt in mich ein, rowdyhaft, aufs Geratewohl werkt sie, ohne sich darum zu kümmern, ob ich auf diese Weise auf sie anspreche, ob ich „etwas spüre“, ein Finger vermutlich in mir, zwei andere bewegen sich wahllos in der Gegend meiner Klitoris auf und ab, gleichzeitig rubbelt und reibt sie ihre gierige, nasse Möse an mir rauf und runter. Und ich liege da, überrumpelt und entsetzt darüber, dass ich es zulasse, entsetzt, dass sich dieser Kontakt so unverfroren stümperhaft abspult, ein keuchendes Gewetze, ein blindes in mich hineinfahren, und los geht es für sie. Dass ich mir das gefallen lasse, ich, die haute cuisine in punkto Sex gewöhnt ist. Aber ich bin der Dynamik ausgeliefert, und betaste jetzt unwillkürlich meine Schamlippen. Gut, denke ich, so ist das also, da will ich aber auch etwas davon haben. Die volle Blase ist vergessen, ihre Ungeschicklichkeit fällt nicht mehr ins Gewicht, ich drücke die Finger auf meine Klit, ich denke mir schnell böse Träume zusammen, um mich noch mehr aufzugeilen: nicht sie, sondern ein unappetitlicher, fetter Typ würde jetzt auf mir liegen, diese Vorstellung ist noch schlimmer als die Realität, und der zwingt mich, es mit ihm zu treiben. Jetzt lass mich rein, ich will dich, ich will dich ficken, niedervögeln, und in diese schlimmen Gedanken hinein kommt sie. Ja, sie kommt, es können kaum mehr als drei Minuten vergangen sein, kriegt sie es, teufelt mir in ihrem Orgasmus davon. Ich schubse ihre Schenkel, die mich in den Sand gepresst haben, von mir hinunter, halte ihre Finger in meiner Möse fest und kommandiere, sie solle weitermachen, continue, si, asi, langsam, sage ich, langsam. Ich reibe meine Klit und klammere mich mit der anderen Hand in die festen Wülste um ihren Hals, und Sekunden, wirklich Sekunden nach ihr ist es soweit, es platzt auf, wie ein Kürbis, der zu Boden prallt, es putzt mich durch, es knallt und galoppiert in mir davon, und ich kralle mich immer noch an ihren Fettmassen fest, wie an einer dicken Gummiwand. Dann ist es vorbei. Wir geben uns herzhafte, saftige Küsse. „Conquistadora”, murmle ich. Die Atmosphäre zwischen uns hat sich entspannt, ist wie in den Tagen zuvor, kumpelhaft schlicht. Ja, ich habe sogar fälschlicherweise den Eindruck, dass mir in diesem Urlaub alle Wünsche in Erfüllung gegangen sind, obwohl eigentlich nichts so eingetroffen ist, wie ich es wollte.
Karin Rick, La Graciosa, Kurzgeschichte in: Bisse und Küsse, Hg. Sophie Hack und Stephanie Kuhnen, Querverlag Berlin