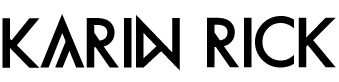Über Alexander Paul Kubelkas großartige Inszenierung von Kleists ‚Amphitryon‘ in
Perchtoldsdorf und die epischen Verwandlungen auf den marmornen Tüchern der Arachne.
Auch der Olymp ist öde ohne Liebe, so Gott Jupiter in Amphitryon, doch die Liebe, so selbstverständlich sie schien, muss mühselig wiedererobert werden, in einem Verwirrspiel aus Schein und Sein. In der ersten Reihe sitzend, niveaugleich mit der Bühne wurde ich unmittelbarer denn gedacht in das Geschehen hineingezogen, Ereignisse, die das Leben der Hauptpersonen für immer verändern würden. Vor uns ein flaches Becken mit knöcheltiefem Wasser als Bühne, darauf zwei Plattformen mit Gebilden aus weißem Marmor, in der Mitte eine kugelvasenförmige Skulptur mit Blütenlippenöffnung, die anderen wie Vorhänge, deren Falten zu Stein erstarrt sind. Dahinter das alte Gemäuer der Burg verschlossen und unnahbar.
Die Story: Gott Jupiter verwandelt sich in Amphitryon, den Feldherrn, um dessen Frau Alkmene zu verführen, aus Laune, aus Rache, aus Sexgier, unerheblich. Dann verliebt er sich auch noch in sie. Alkmene glaubt, ihr Gatte ist von gewonnener Schlacht frühzeitig, heimlich nur zu ihr zurückgekommen und verbringt eine leidenschaftliche Liebesnacht mit ihm. Vor dem Morgengrauen verlässt er sie wieder. Der richtige Amphitryon erscheint wenig später, wird mit den Worten „so früh zurück?“ erstaunt empfangen und erfährt von der Liebesnacht, an der er nicht beteiligt war, was Alkmene jedoch wider sein besseres Wissen behauptet.
Von nun an versuchen beide einander von der eigenen Wahrheit zu überzeugen. Das misslingt. Weder kann Alkmene glaubhaft machen, dass sie nur ihn sah, fühlte, spürte und begehrte, noch er ihr, dass er es nicht war, jetzt aber schon ist. Für sie sind er und der nächtliche Verführer ein und dieselbe Person, für ihn beginnen Zweifel an der eigenen Identität. Die für Alkmene bedingungslose Liebe und die für Amphitryon unschuldige Sicherheit, alles zu besitzen – die Ehefrau und ein fraglos gesichertes, feldherrliches Ich – gibt es nicht mehr, die Idylle zerfällt, der Zweifel an sich selbst und am anderen zerstört die Liebe. Als Jupiter erneut auftaucht, wieder in Amphitryons Gestalt, und beide nebeneinanderstehen, bestehen müssen, wird der Gott für Amphitryon gehalten, er kann die Illusion glaubhafter erzeugen als der Richtige die Realität. Das Stück hat kein Happy End, die Eheleute bleiben ratlos, konsterniert, düpiert und im Gefühl der Ohnmacht zurück. Alkmene wird Herakles gebären, einen Halbgott, das soll der Trost für dieses Schlamassel sein?
Die Geschichte der Metamorphosen und ihrer unheilvollen Folgen entwickelt sich in einer Wasserlandschaft, nie hat man sicher und für lange Zeit festen Boden untere sich. Der Ponton oder ein schnell übers Wasser gelegtes Brett sind trügerische Rettungsinseln. Das schwimmende, wellenschlagende Kleider und Mäntel verschlingende das Gehen schwermachende, umherspritzende Element ist überall, und überall unbequem. Nur Jupiter, zu Beginn und in der Szene der Konfrontation als Tänzer in Erscheinung tretend, kann das Wasser in Pirouetten elegant und stilvoll beherrschen, die anderen waten schwerfällig, springen, spritzen, verlieren das Gleichgewicht, Amphitryon, der stolze Bezwinger Thebens wird darin zum strauchelnden Tollpatsch, unfähig aufrecht zu stehen oder zu gehen – ein Sinnbild seiner plötzlichen Orientierungslosigkeit, des Wankens und möglichen Scheiterns seines bisherigen Lebensentwurfs. Wenn sogar sein Diener den anderen eher erkennt als ihn, und die Ehefrau ohne zu zögern mit dem anderen ins Bett stieg, was bleibt dann von ihm übrig?
Und was bleibt von Alkmenes Begehren? Sie war sich so sicher, dass es der Gatte war, mit dem sie sich innig verband. Als Jupiter erneut zu ihr kommt, wieder als Amphitryon, und sie zu überzeugen versucht, dass er diesmal Gott selbst ist und sich in sie verliebt hat, glaubt sie ihm kein Wort, stößt ihn von sich, fühlt sich gefoppt, verraten und wird immer demütiger und verzweifelter. Ist sie als Ehefrau nun gut genug? Oder hat sie ihr Begehren nicht im Griff? Ist ihre Leidenschaft ehebrecherisch, promisk? Bei Frauen ist es die Reinheit der Lust, die auf dem Spiel steht, bei Männern die Identität und das Hab und Gut. Dieses Geschlechtergefälle wird von Kleist, der seiner Zeit voraus war, exemplarisch vorgeführt.
Die Sprache Kleists, Blankverse, die sich mit der Rede des anderen, des Gegenübers verknüpfen können, beeindruckt immer noch, nach 213 Jahren. Man bangt mit ihrem Rhythmus mit, die Klänge der Worte dringen tief in Alkmenes Verzweiflung ein. Die Sprache schafft es, mit der komplexen Struktur ihres Versmaßes, die eng miteinander verschränkten Gefühle des Zweifels, Aufbegehrens, der Wut, des Schmerzes zwischen Alkmene, Amphitryon und Jupiter lebendig zu machen. Im Labyrinth der Unwahrheiten, Verstellungen und trügenden Scheins. Amphitryon, der doppelt Gequälte, so lautet die Übertragung aus dem Griechischen, schafft den Sprung zur Überwindung der Schmach nicht, zumindest nicht auf der Bühne. Sein Diener, Sosias, in dessen Namen der Doppelgänger bereits angelegt ist, erleidet dasselbe Schicksal. Er wird von Merkur ausgetrickst, der seine Gestalt annimmt, um Jupiter heimlich in Schloss zu bringen. Merkur, das flüchtige Element, das kaum da, schon wieder weg ist, Unheil stiftet und verschwindet, bringt auch Sosias dazu, unter Androhung von Schlägen sein Ich aufzugeben:
Zu Merkur: ‚Sage mir, da ich Sosias nicht bin, wer ich bin. Denn etwas, gibst du zu, muss ich doch sein.‘ ‚Dein Stock kann machen, dass ich nicht mehr bin. Doch nicht, dass ich nicht Ich bin, weil ich bin.‘
Staub, Stein und Wasser, nix ist fix.
Alkmenes Welt ist das Behauen, Gestalten von kostbaren Steinen, sie verbringt das Warten auf den Mann nicht am Spinnrad oder beim Sticken, sondern ist Künstlerin und bemächtigt sich harten, schwer formbaren Materials. Marmorstaub umgibt sie und trübt ihren Blick, macht ihr Gesicht weiß, legt sich auf Wimpern, Haare, Lippen. Der Staub als Metapher für das Erstarren und Verharren, für die Blindheit mit der wir geschlagen sind, für den feinen Mantel der Uneindeutigkeit. Staub wirft sie auch ihrem Mann zu, oder ist es der Gott selbst, der ihn abkriegt? Erdenstaub, den Jupiter abschütteln kann, sie aber nie. Zu Staub werden alle Irdischen, nur der Gott bleibt für immer, kann schwerlos durch das Wasser tanzen, durch Raum und Zeit.
Der Stoff Amphitryon ist alt, von Ovid in seinen ‚Metamorphosen‘ erzählt, von Plautus 200 v. Chr. Bearbeitet, von Moliere 1668 zur Komödie gemacht. Kleist war der erste, der, 1811, in dieser Geschichte die quälenden, tiefen Seiten für die Psyche herausarbeitete. Das Äußere kann täuschen, die innere Wahrheit ist schwer zu erkennen. ‚Er ahnte früher als andere, dass niemand zwischen Schein und Sein zu unterscheiden vermag, seine Zeitgenossen waren von dieser Botschaft heillos überfordert… sind es bis heute. In Amphitryon schafft er es, den Riss in der menschlichen Identität aufs Tragischste und zugleich aufs Komischste darzustellen.‘ 1
Alexander Paul Kubelkas Bühnenlandschaft ist karg, post-apokalyptisch. Das Wasser erscheint als schwere, schwarze Masse, die nicht nur kein Leben mit sich bringt, sondern auch kaum zu durchdringen ist. Kein Tier, keine Pflanze, keine Menschen sind zu sehen. außer den vieren, die um ihr selbst zusammengebasteltes, jetzt zersplittertes Ich kämpfen. So schaut unsere Suche nach unserer Identität heute aus. Wir ringen darum, zu wissen, was es bedeutet, man selbst zu sein.